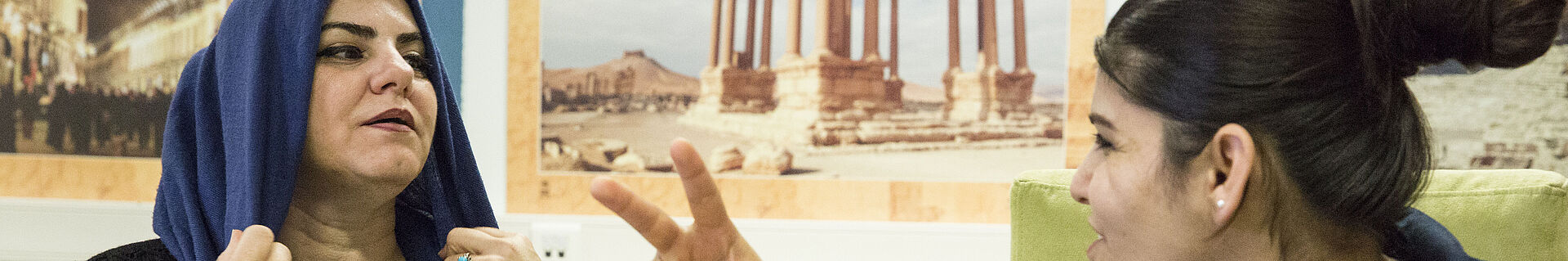Viele der nach Deutschland einreisenden Schutzsuchenden sind psychisch schwer belastet oder traumatisiert. Durchgeführte Studien weisen darauf hin, dass bei etwa einem Drittel der erwachsenen Schutzsuchenden psychische Erkrankungen diagnostiziert werden könnten, darunter posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), Depressionen oder Angstzustände. Aufgrund traumatisierender Erfahrungen im Herkunftskontext, während der Flucht und im Aufnahmekontext hat eine große Anzahl in Deutschland schutzsuchender Menschen einen psychosozialen Unterstützungsbedarf, der unversorgt bleibt oder nicht bedarfsgerecht versorgt wird - mit erheblichen Folgekosten nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für Bund, Länder und Kommunen aufgrund von Chronifizierungen und ausbleibenden Integrations- und Teilhabemöglichkeiten.[1] Problematisch ist diesbezüglich auch, dass es im Aufnahmekontext noch keine systematische Identifizierung dieser besonderen Schutz- und Unterstützungsbedarfe gibt.
1. Bedarfsgerechte Versorgung durch multimodale Angebote
Es ist sinnvoll, in die frühzeitige Identifizierung und Versorgung von psychischen Erkrankungen bei Geflüchteten zu investieren und die betroffenen Personen zeitnah psychosozial zu unterstützen. Denn durch therapeutische Interventionen ist es möglich, körperliche, emotionale und kognitive Beeinträchtigungen von psychisch belasteten Geflüchteten zu behandeln und langfristige negative Folgen zu verhindern bzw. abzumildern. Psychosoziale Unterstützung kann ferner dazu beitragen spezifische Belastungen und besondere Bedarfe ressourcenstärkend zu adressieren und die Ratsuchenden durch Beratung, in u.a. aufenthalts- und sozialrechtlichen Fragestellungen, zu stärken. Im Koalitionsvertrag hatte sich die Bundesregierung konsequenterweise dafür ausgesprochen, “[v]ulnerable Gruppen … von Anfang an [zu] identifizieren und besonders [zu] unterstützen.” (Koalitionsvertrag 2021, S. 111). Dies wurde bislang nicht umgesetzt.
Psychisch belastete Geflüchtete treffen in Deutschland auf ein Versorgungssystem, in dem vielerorts bereits der bestehende Bedarf an psychosozialer und psychotherapeutischer Unterstützung nicht gedeckt werden kann. Die Folge sind häufig fehlende, zu späte oder wenig wirksame Behandlungen und Hilfeleistungen. Zusätzlich zur allgemein schlechten Versorgungslage bei der psychosozialen und psychotherapeutischen Unterstützung ist es für Geflüchtete noch schwieriger, adäquate Hilfe zu erhalten. In den ersten 36 Monaten ihres Aufenthaltes in Deutschland ist eine Versorgung gem. §§ 4 und 6 AsylbLG beschränkt, daher wird Psychotherapie in der Regel nicht gewährt.
Die Psychosozialen Zentren (PSZ) leisten bundesweit psychosoziale und psychotherapeutische Unterstützung für Geflüchtete. Der psychosoziale Ansatz umfasst an den Bedarfen der Klient*innen orientierte, ganzheitliche und multimodal ausgerichtete Angebote, die in multiprofessionellen Teams adressiert werden. Dazu zählen psychotherapeutische Verfahren, psychologische und soziale Beratung, Rechtsberatung, niedrigschwellige Angebote und Psychoedukation, die zusammengenommen der psychosozialen Gesundheit zugutekommen und Teilhabechancen Schutzsuchender z.B. in Sozialraum und Arbeitsmarkt ermöglichen.
Psychotherapie mit Geflüchteten wird deutlich geprägt durch migrationsspezifische Umstände. Die persönliche Lebenslage und die möglicherweise nicht vorhandene externe Stabilität und Sicherheit müssen - ebenso wie zumeist fehlende deutsche Sprachkenntnisse - im Kontext einer Therapie beachtet werden. In den PSZ wird, neben der multiprofessionellen Zusammenarbeit mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die bedarfsgerechte Versorgung durch die transkulturelle Professionalität in allen Bereichen der psychosozialen Arbeit und die Einbeziehung von Sprachmittlung gewährleistet. Die Unterstützung ist für die Klient*innen kostenfrei und wird unabhängig von Herkunft oder Aufenthaltsstatus gewährleistet.
Die Praxis der PSZ zeigt, dass durch die Breite des Angebots den Bedarfen vieler Betroffener entsprochen werden kann und kostenintensivere Verfahren, die in Folge der Behandlung chronifizierter Krankheiten, etwa durch stationäre Versorgung, vermieden werden können. Als Koordinations- oder Kompetenzzentren wirken die PSZ darüber hinaus auch unterstützend und vermittelnd für andere Leistungserbringer im Gesundheits- und Sozialbereich. Zu den Aufgaben der PSZ gehört daher auch, die mit geflüchteten Menschen arbeitenden Akteur*innen zu sensibilisieren und damit die Versorgung von psychisch belasteten und traumatisierten Asylsuchenden und geflüchteten Menschen in Einrichtungen der Flüchtlingssozialarbeit und in Regelinstitutionen insgesamt zu verbessern.
2. Finanzierung der PSZ
Psychosoziale Zentren finanzieren sich häufig aus mehreren Quellen. Die Bundesförderung durch das Bundesprogramm Beratung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge ist eine zentrale Säule in der Finanzierung, um Standards und Kapazitäten der psychosozialen Versorgung bundesweit anzugleichen. Darüber hinaus werden diese Mittel auch für komplementierende Maßnahmen bei einer möglichen Landes- oder Kommunalfinanzierung oder zu einer Anschubfinanzierung für den Ausbau der psychosozialen Versorgung und zur Verringerung sog. “weißer Flecken” in der Versorgungslandschaft eingesetzt.
Doch aufgrund einer vielerorts unzureichenden Finanzierung, die sich durch die starken Kürzungen im Bundesprogramm Beratung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge im Jahr 2024 weiter zugespitzt hat, können die PSZ der hohen Nachfrage nach psychotherapeutischer und psychosozialer Unterstützung der Zielgruppe nicht adäquat gerecht werden. Die Wartelisten der einzelnen Zentren sind seit Jahren lang. Immer wieder müssen PSZ ihre Wartelisten schließen, da sie eine Behandlung aus Kapazitätsgründen nicht in Aussicht stellen können. Dies ist nur ein Hinweis auf die massive Unterversorgung. Die Zahl derer, die nicht versorgt werden, ist deutlich höher, wie Zahlen des jährlichen Versorgungsberichts der BAfF zeigen. Gründe hierfür sind fehlende Versorgungsstrukturen vor Ort und unzureichende Versorgungskapazitäten aufgrund fehlender und nicht nachhaltiger Finanzierung.
Eine Aufstockung der Mittel und eine längerfristige Finanzierung ist demnach dringend geboten, um die kontinuierliche Arbeit der PSZ gewährleisten zu können und den Abbruch von Therapien sowie den Verlust von qualifiziertem Fachpersonal zu vermeiden. Dies käme auch völkerrechtlichen und grundgesetzlich verankerten Ansprüchen, wie der UN-Antifolterkonvention und der EU-Aufnahmerichtlinie sowie dem Anspruch des Koalitionsvertrages nach einer Verstetigung der finanziellen Unterstützung der PSZ (durch die kontinuierliche Bereitstellung finanzieller Mittel in entsprechender Höhe), nach.
Eine Abfrage der in den Wohlfahrtsverbände und der BAfF organisierten, bundesgeförderten PSZ hat ergeben, dass diese angesichts des enormen Bedarfs von Seiten der Schutzsuchenden zusätzliche Angebote bei einer entsprechenden Förderung durch den Bund in 2025 realisieren könnten. Diese umsetzbaren Angebote entsprächen einer zusätzlichen Förderung i.H. von 14 Mio. Euro. Zusammengenommen mit der in diesem Jahr gewährten Summe läge der Bedarf für die Beratung und Betreuung geflüchteter Menschen in Deutschland bei ca. 27 Mio. Euro.
Die PSZ sind fast alle Mitglied in einem der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und/oder Mitglied bei der BAfF. Die Wohlfahrtsverbände übernehmen im Bundesprogramm nicht nur die Koordinierung und fachliche Unterstützung der PSZ, sondern setzen sich als Zentralstellen im Kontext Flucht für die Qualifizierung, Vernetzung und den Wissenstransfer in Politik und Öffentlichkeit ein. Darüber hinaus engagieren sie sich in der Qualifizierung von Fachkräften. Sie unterstützen bei der Qualitätssicherung, fördern die Vernetzung und arbeiten bei der Weiterentwicklung der Beratung und Betreuung geflüchteter Menschen eng zusammen Die BAfF als Dachverband der Psychosozialen Zentren ist seit mehr als 25 Jahren zentrale Akteurin für die Bündelung der Kompetenzen in den Bereichen psychosoziale Versorgung und Trauma nach kollektiver Gewalterfahrung, Folter und Flucht, die Begleitung, die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Arbeit der Psychosozialen Zentren im gesamten Bundesgebiet. Derzeit 48 Psychosoziale Zentren sind Mitglied der BAfF und verpflichten sich damit zur Einhaltung der BAfF-Leitlinien.
[1] Vgl.:https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.897126.de/24-12-4.pdf