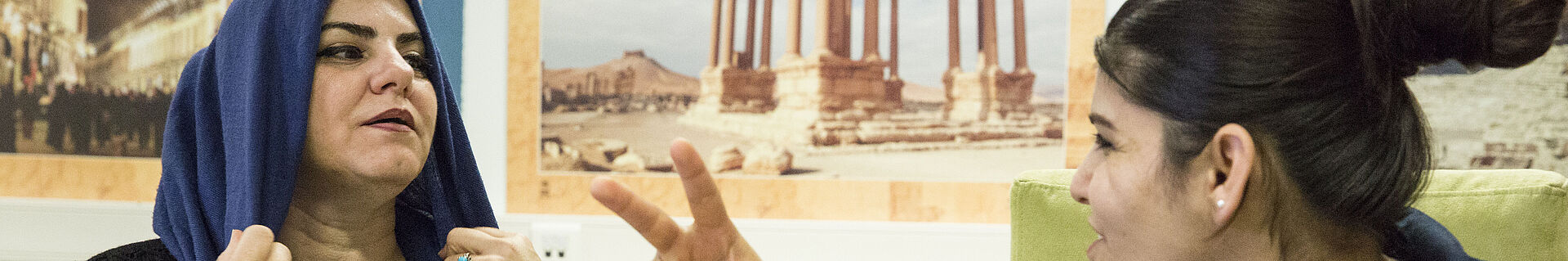Seit einiger Zeit steigt die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland und auch die unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Die Versorgung dieser Kinder und Jugendlichen stellt einige Kommunen vor große Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die finanziellen Aufwendungen. Hierfür muss eine Lösung gefunden werden.
Im Antrag 444/14 heißt es: „Ziel der bundesweiten Verteilung ist es, eine kindeswohlgerechte Versorgung von unbegleiteten Minderjährigen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu gewährleisten und die Verantwortung für die Betreuung und Unterbringung der unbegleiteten Minderjährigen gleichmäßig auf die öffentlichen Träger der Jugendhilfe zu verteilen“. Wenn auch beide Ziele grundsätzlich zu begrüßen sind, so dienen die vorgesehenen Maßnahmen ausschließlich dem zweiten Ziel. Dabei ist jedoch nicht nachvollziehbar, warum für eine gerechtere Lastenverteilung statt der Finanzen Kinder und Jugendliche umverteilt werden sollen.
Der Gesetzesantrag im Lichte supra- und internationaler Rechtsnormen
Als supranationales Recht ist in erster Linie die Europäische Grundrechtecharta heranzuziehen, die hier einschlägig ist:
Art. 24 Rechte des Kindes
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
Da es sich hier um europäisches Primärrecht handelt, ist keine Abwägung mit deutschen Rechtsnormen vorzunehmen, sondern letztere müssen diesem Grundsatz entsprechen.
Das vorgeschlagene Umverteilungsverfahren widerspricht diesem Grundsatz. Entsprechend Art. 24 Abs. 1 der Europäischen Grundrechtecharta käme eine Umverteilung nur in Betracht unter Mitsprache des Kindes. Da es sich zumeist um ältere Kinder mit hohem Reifegrad handelt, wäre ihre Meinung entsprechend stark zu gewichten. Insbesondere widerspricht das vorgeschlagene Verfahren jedoch Art. 24 Abs. 2 der Europäischen Grundrechtecharta, denn die vorrangige Erwägung ist ganz offensichtlich gerade nicht das Wohl des Kindes, sondern die der Lastenverteilung.
Artikel 24 Abs. 2 S.4 der Richtlinie 2013/33/EU zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Aufnahmerichtlinie) sieht vor: „Wechsel des Aufenthaltsortes sind bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auf ein Mindestmaß zu beschränken.“ Dies ist aus Sicht der BAGFW so zu verstehen, dass ein Wechsel des Aufenthaltsortes und damit ein Zuständigkeitswechsel des Jugendamtes nur infrage kommen, wenn die Sicherung des Kindeswohls dies notwendig macht. Da dies nicht gegeben ist, sondern die Lastenverteilung Ziel der Umverteilung ist, ist dies mit dieser Rechtsnorm nicht vereinbar. Auch diese Richtlinie als europäisches Sekundärrecht hat Vorrang vor nationalem Recht und ist somit zu befolgen.
Entsprechend Art. 3 der UN-Kinderrechtskonvention ist das Kindeswohl ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Mit der Rücknahme der Vorbehaltserklärung gegenüber der UN-Kinderrechtskonvention am 03. Mai 2010 gilt der Vorrang des Kindeswohls unmittelbar. Dies bedeutet, „bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig zu berücksichtigen ist“.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass das Verständnis des Kindeswohlbegriffs im deutschen Sprachraum nicht ausreicht, um die Definition inter- und supranationaler Rechtsnormen zu verstehen. Der Begriff „best interest of the child“ geht über den historisch gewachsenen, deutschen Begriff des Kindeswohls hinaus.
Der Kindeswohlbegriff im deutschen Recht bestimmt, wann der Staat in Ausübung seines Wächteramtes in das Elternrecht nach Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz eingreifen darf. Der Begriff ist in der Materialisierung des Eingriffsrechts des Staates in das elterliche Grundrecht sehr eng gefasst. Er darf nur dann eingreifen, wenn das Kindeswohl (erheblich) durch die das Grundrecht innehabenden Eltern gefährdet ist. Aufgrund dieser Ableitung hat der Begriff vor allem im Familienrecht eine große Bedeutung und ist in diesem Rechtsgebiet gewachsen. Das Kindeswohl im Spannungsfeld zwischen Elternrechten und staatlichem Wächteramt manifestiert sich daher nicht vorwiegend als ein Anspruch von Kindern an den Staat als eigene Rechtssubjekte im Sinne umfassender aktiver Förderung und Schutz, sondern bezieht sich vor allem auf den Schutz von Ehe und Familie und den Eingriff zur Abwendung einer Gefährdung des Kindeswohls.
Der Begriff des Kindeswohls „best interest of the child“ der UN-Kinderrechts-konvention ist jedoch nicht verbunden mit dem staatlichen Eingriffsrecht in das grundrechtlich geschützte Elternrecht. Hier sind Kinder nicht Dritte im Spannungsfeld zwischen Elternrechten und Wächteramt, sondern in erster Linie Rechtssubjekte mit eigenen Rechten gegenüber ihren Eltern als auch gegenüber der Gesellschaft und dem Staat. Wenngleich die UN-Kinderrechtskonvention auch die Familie als die zentrale Institution für das Kindeswohl definiert, geht sie deutlich darüber hinaus, in dem sie Gesellschaft und Staat eine eigene aktive Rolle zur Verwirklichung des Kindeswohls zuweist und nicht nur der Abwendung einer Gefährdung des Kindeswohls. Er steht vielmehr als ein Oberbegriff von Rechten, die im Weiteren in der UN-Kinder-rechtskonvention niedergelegt und ausdifferenziert sind und damit in umfänglicherer Weise das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit sicherstellen sollen. Der Staat ist hier nicht nur Wächter über die Ausübung des Elternrechts, sondern selbst verpflichtet, im besten Interesse des Kindes in allen Belangen, die Kinder betreffen, zu handeln. Hier ist insbesondere auf Art. 22 der UN-Kinderrechtskonvention, der über die anderen Kinderrechte hinaus, die besonderen Rechte von Flüchtlingskindern benennt, zu verweisen.
Gleichwohl bedeutet die geforderte vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls nicht, dass es absoluten Vorrang hat und nicht durch andere gewichtige Gründe auch verdrängt werden könnte, jedoch muss bei jeder Kinder berührenden Entscheidung einer öffentlichen Stelle oder privaten Stelle geprüft werden, ob das Kindeswohl beeinträchtigt wird und begründet werden, warum es ggf. hinter anderen Gründen zurückstehen muss, die den Vorrang des Kindeswohls verdrängen.
Die Regelungen in Abwägung mit dem Grundsatz des Kindeswohls
Dem Ziel des Kinder- und Jugendhilferechts gemäß § 1 SGB VIII sollten die darauf folgenden Rechtsnormen nicht entgegenstehen. Eine strukturelle, möglicherweise im Vollzug automatisierte Verteilungsregelung widerspricht dem Grundsatz, dass das Kindeswohl einzelfallbezogen zu definieren und der Kindeswille zu berücksichtigen ist. Es würde nicht nur einen erheblichen bürokratischen und damit erneuten finanziellen Aufwand hervorrufen, diese Abwägung einzelfallbezogen vorzunehmen. Es ist auch kaum vorstellbar, dass in einer Abwägung der Lastenverteilung mit dem Kindeswohl letzteres zurückzustehen hätte, gerade vor dem Hintergrund, dass auch andere Formen der Lastenverteilung umsetzbar sind und nicht zum Beispiel eine Gefahr der öffentlichen Sicherheit und Ordnung droht.
Nach dem Gesetzesantrag sollen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht nur umverteilt werden, sondern auch vor Abschluss der Inobhutnahme ein Zuständigkeitswechsel erfolgen können. In der Begründung zum Gesetzesantrag (BR-Drucksache 443/14) wird beklagt, dass die interkommunale Verteilung von unbegleiteten Minderjährigen derzeit nur teilweise im Kinder- und Jugendhilferecht berücksichtigt sei. Ein Zuständigkeitswechsel sei erst nach Abschluss der Inobhutnahme und nur dann möglich, wenn unbegleitete Minderjährige nach Asyl nachsuchen. Dies ist richtig, jedoch auch fachlich begründet und sollte aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege so beibehalten werden. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege würden es hingegen befürworten, den Zuständigkeitswechsel auch bei Asylantragstellung zu streichen. Diese Regelung führt häufig dazu, dass minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in das Asylverfahren gedrängt werden, obwohl dies für ihre Aufenthaltssicherung und damit ihr Wohl nachteilig sein kann, insbesondere dann, wenn später der Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wird. Um diese negativen Folgen zu verhindern, müsste die Zuständigkeit daher zumindest solange erhalten bleiben, bis über den Asylantrag positiv entschieden wurde.
Die Regelung, dass ein Jugendamt die Inobhutnahme eines anderen Jugendamtes fortsetzt, dürfte in der Praxis oftmals negative Begleiterscheinungen hervorrufen und damit dem Kindeswohl entgegenstehen. Es würde einen Wechsel von Ansprechpartnern bzw. Bezugspersonen in einem laufenden Verfahren für die Kinder darstellen, auf Seiten der Jugendämter zu Verlust von Information und dadurch zu Mehrarbeit führen. Die Erfahrung zeigt, dass die Verständigung von Jugendämtern untereinander aus Gründen des Datenschutzes nicht immer im Interesse einer transparenten Kommunikation aller verfahrensrelevanten Fakten verläuft. Es sollten daher möglichst keine Verfahren etabliert werden, deren Erfolg von einer reibungslosen Kommunikation abhängt. Aus diesen Gründen sollte zunächst das Clearingverfahren abgeschlossen und damit der jugendhilferechtliche Bedarf der Kinder und Jugendlichen festgestellt sein. Erst dann sollte ein Wechsel in eine geeignete Einrichtung erfolgen. Da dieser dann aus Gründen des Kindeswohls vollzogen wird, ist er auch mit geltendem, höherrangigem Recht vereinbar.
Insofern eine unverzügliche Verteilung angedacht ist, wird diese nicht nur an den Anforderungen des Verwaltungsverfahrens scheitern, da beispielsweise zumindest eine vorläufige Altersschätzung vorgenommen werden muss, um zu klären, ob der Jugendliche überhaupt in die Zuständigkeit des SGB VIII fällt. Allein diese kann erfahrungsgemäß einige Wochen in Anspruch nehmen. Es stellt sich auch die Frage, ob es zu einer Umverteilung nicht eines rechtsmittelfähigen Beschlusses bedarf, so dass allein das Einlegen von Rechtsmitteln gegen die Umverteilung ein unverzügliches Verfahren vereiteln würde. In dieser Zwischenzeit könnte keine zielgerichtete pädagogische Arbeit stattfinden. Vor allem können bei einem Verfahren zur unverzüglichen Verteilung keine einzelfallbezogenen Bedarfe in einer Gesamtschau bewertet werden, da diese noch nicht oder nur lückenhaft bekannt sind. Es kann keine Würdigung vorgenommen werden, was im Sinne des Kindeswohls erforderlich ist.
Verhältnis von Jugendhilfe und Aufenthalts- und Asylverfahrensrecht
Im Antrag 444/14 wird zudem festgestellt, dass eine Klarstellung der Frage erforderlich sei, wie die Verpflichtung zur Inobhutnahme, Betreuung und Begleitung der unbegleiteten Minderjährigen mit dem Aufenthaltsgesetz und dem Asylverfahrens-gesetz in Einklang zu bringen ist. Fehlende gesetzliche Regelungen würden immer wieder zu erheblichen Problemen in der Praxis führen, die eine weitere Belastung von öffentlicher und freier Jugendhilfe nach sich ziehen. Aus Sicht der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege kann für Rechtsanwender z.B. im administrativen Verfahren abgeleitet aus Art. 24 der Europäischen Grundrechtecharta als gegenüber dem Aufenthalts- und Asylrecht höherrangiges Recht klargestellt werden, dass das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist und im Zweifel Normen des Aufenthalts- und Asylverfahrensrechts verdrängt. An dieser Stelle sei auch auf die Koalitionsvereinbarung der derzeitigen Bundesregierung von SPD und CDU/CSU verwiesen: „Die UN-Kinderrechtskonvention ist Grundlage für den Umgang mit Minderjährigen, die als Flüchtlinge unbegleitet nach Deutschland kommen. Wir werden die Handlungs-fähigkeit im Asylverfahrens- und Aufenthaltsrecht auf 18 Jahre anheben und dadurch den Vorrang des Jugendhilferechts für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge festschreiben“ (S.110 der Koalitionsvereinbarung). Hinzuzufügen ist, dass der Wirkungskreis der UN-Kinderrechtskonvention sich nicht auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beschränkt, sondern alle tatsächlich in Deutschland lebenden Kinder so auch Flüchtlingskinder, die in Begleitung ihrer Eltern nach Deutschland kommen, umfasst.
Fazit
Dieser Gesetzentwurf widerspricht dem Wohl des Kindes und damit einschlägigen Rechtsnormen. Im Gesetzesantrag zur Änderung des SGB VIII (BR-Drucksache 443/14) taucht das Wort Kindeswohl nicht auf Es wird allein darauf hingewiesen, dass es sich um einen Eingriff in das elterliche Grundrecht handelt, ohne dass die damit verbundenen Maßnahmen vor diesem Hintergrund näher erörtert werden. Das Ruhen der elterlichen Sorge ermächtigt den Staat nicht, Maßnahmen zu ergreifen, es sei denn, sie dienen vorrangig dem Kindeswohl.
Der Grundsatz der örtlichen Zuständigkeit sollte erhalten bleiben. Eine Übertragung der Zuständigkeit sollte nur aus Gründen des Kindeswohls möglich sein. Ein Verteilungssystem würde einen zusätzlichen Abbruch und Neuanfang für die Kinder und Jugendlichen bedeuten. Eine für die betreffenden Kinder und Jugendlichen nicht nachvollziehbare Umverteilung gegen ihren Willen wird eher dazu führen, dass sie sich entziehen. Dies ist vor dem Hintergrund, dass sie oft schon lange auf der Flucht sind und Stabilität brauchen, nicht sachgerecht. Es widerspricht dem Grundsatz der Pädagogik, dass das stärkste Instrument für eine erfolgreiche Hilfe der Aufbau stabiler Bindungen ist.
Die Anforderung an ein Umverteilungssystem, effizient und effektiv zu sein, steht im Widerspruch zur Anforderung, einzelfallbezogene Bedarfe zu berücksichtigen. Einige der stark beanspruchten Kommunen sind Zielort der Jugendlichen, während andere Kommunen vor allem deshalb zuständig sind, weil Kinder und Jugendliche in ihrem Zuständigkeitsbereich aufgegriffen werden, diese jedoch dort nicht verbleiben wollen. Vor allem für die Stadtstaaten als häufiger Zielort würde eine solche Regelung daher bei Berücksichtigung des Rechts der Kinder und Jugendlichen auf Mitsprache keine Entlastung bringen.
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege lehnen daher die geplanten Regelungen im vorliegenden Gesetzesantrag ab. Probleme aufgrund der Zunahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen werden nur verlagert, möglicherweise weitere geschaffen. Aus der praktischen Erfahrung mit Verteilungsregelungen wie dem EASY-System für erwachsene Schutzsuchende ist zu befürchten, dass das Kindeswohl durch eine analoge Anwendung nicht beachtet oder verletzt wird. Im EASY-System werden systematisch humanitäre Aspekte unberücksichtigt gelassen.
Zentraler Ansatzpunkt, um den Herausforderungen einiger Jugendämter zu begegnen, wäre ein finanzieller Ausgleich zwischen Kommunen und Ländern statt einer Umverteilung von Kindern und Jugendlichen. Der Bundesrat hatte am 22.03.2013 einen Beschluss (Bundesratsdrucksache 93/13) gefasst, um das Ziel einer ausgewogeneren Kostenverteilung zu erreichen. Die dort beschriebene Regelung erscheint deutlich besser geeignet, eine Lösung herbeizuführen, sollte aufgegriffen und vor dem Hintergrund der neueren Entwicklungen weiterentwickelt werden. Für den Erfolg einer Kostenerstattungsregelung ist es notwendig, dass alle Kosten, beispielsweise auch die Verwaltungskosten, berücksichtigt werden.
Insofern im Bereich einiger Jugendämter die örtliche Aufnahmekapazität an ihre Grenzen stößt, könnten Kommunen vor Ort miteinander kooperieren und Jugendliche in der kommunalen Nachbarschaft bei grundsätzlicher Zuständigkeit des örtlichen Jugendamtes verbleiben, statt bundesweit verteilt zu werden. Zu diesem Zweck wäre auch denkbar, dass eine Kostenregelung so konzipiert wird, dass für Kommunen Anreize geschaffen werden, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Dies könnte ein Pull-Effekt anderer Kommunen auslösen, um die stark beanspruchten Kommunen zu entlasten, ohne dass es eines Verteilungssystems bedarf. Insbesondere kann es für eine Kommune auch hilfreich sein, wenn die im Rahmen der Jugendhilfe aufgenommenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auf den Königsteiner Schlüssel zur Aufnahme von Asylsuchenden insgesamt angerechnet würden. Ein Wohnortwechsel muss jedoch effektiv möglich sein, wenn Gründe des Kindeswohls dies erfordern, z.B. wenn an einem anderen Ort nahe Verwandte des unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings leben. Die Zusammenführung z.B. mit nahen Verwandten könnte auch Kosten der Jugendhilfe reduzieren.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege plädiert dafür, in allen Bundesländern Standards in der Jugendhilfe zu etablieren, die dem Kindeswohl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gerecht werden. Trotz Fortschritten in den letzten Jahren, gibt es hier große Unterschiede und an einigen Orten noch deutlichen Verbesserungsbedarf. Wenn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge umverteilt werden sollen, da aufgrund der Quantität in besonders beanspruchten Kommunen das Kindeswohl nicht sichergestellt erscheint, so kann ebenfalls aufgrund der Unterschiede in den Standards nicht davon ausgegangen werden, dass diese am Zielort nach Umverteilung besser sind.